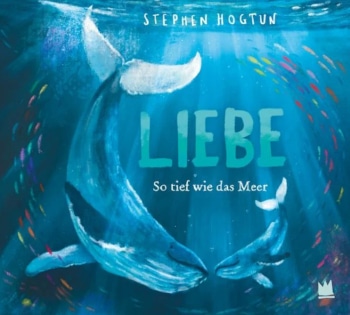Kirsten Boie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin, Lehrerin und Autorin von rund 100 Kinder- und Jugendbüchern. Ihr Leitmotiv lautet: „Kinder haben ein Recht auf Kindheit.“ Die von ihr und ihrem Mann gegründete Möwenweg-Stiftung steht unter dem Credo: „Kinder können sich nicht aussuchen, in welche Umstände sie hineingeboren werden.“
Kirsten Boie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin, Lehrerin und Autorin von rund 100 Kinder- und Jugendbüchern. Ihr Leitmotiv lautet: „Kinder haben ein Recht auf Kindheit.“ Die von ihr und ihrem Mann gegründete Möwenweg-Stiftung steht unter dem Credo: „Kinder können sich nicht aussuchen, in welche Umstände sie hineingeboren werden.“
Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Bödecker-Kreise hielt sie den folgenden Vortrag, den wir hier mit freundlicher Genehmigung in gekürzter Fassung abdrucken.
Zwei Kindheiten, zwei Wege ins Leben mit und ohne Bücher
Justin – ein Leben ohne Bücher
Justin – er könnte auch Recep heißen oder Wladimir – wird in eine in Deutschland ganz und gar durchschnittliche Familie geboren, in der Bücher, Zeitungen und Zeitschriften schon seit Generationen keine Rolle gespielt haben. In der Wohnung gibt es inzwischen, schließlich haben die Eltern internetfähige Smartphones, nicht mal mehr ein Telefonbuch. Justins Eltern haben ihn sehr lieb und tun alles für ihn, wovon sie glauben, dass es ihn glücklich macht und dass es ihm nützt. Vorlesen gehört nicht dazu. – Vorlesen hat sie selbst ja auch nie glücklich gemacht, und sind sie nicht bisher auch ohne Bücher ganz gut durchs Leben gekommen?
Chips, Konsole und Dauerfernsehen statt Geschichten
Als Justin ein Jahr alt ist, sitzt er manchmal schon ein paar Augenblicke länger auf dem Boden vor dem Fernseher, der den ganzen Tag läuft. Er bekommt Chips und Süßes, aber langweilige Mahlzeiten, bei denen die ganze Familie gemeinsam am Tisch sitzt und redet, gibt es nicht so oft. Beim Essen sitzt man, das ist ja viel gemütlicher, am Couchtisch und guckt auf den Fernseher. – Justins Vater liebt seine X-Box, und auch da darf Justin schon manchmal mitmachen. Dann fühlt Justin sich zufrieden und glücklich, wie er da so mit seinem Papa gemeinsam etwas tun darf. Zufrieden und glücklich fühlt er sich auch, wenn er neben seiner Mama auf dem Sofa sitzt und dabei ist, wenn sie zappt.
Weil seine Eltern ihn so liebhaben, kaufen sie Justin zu Weihnachten einen Fernseher für sein Zimmer, als er fünf Jahre alt ist. Vielleicht kaufen sie ihm auch schon eine eigene Spielkonsole, wenn das Geld dafür reicht – in manchen Familien gehen Mütter dafür putzen und machen Väter Überstunden.
Der erste Schultag – große Erwartungen
Dann kommt Justin in die Schule. Darauf hat er sich sehr gefreut: Er möchte endlich lesen lernen und schreiben und rechnen. Er hat auch so eine Ahnung, dass die komischen Zeichen, die es überall gibt, etwas bedeuten müssen. Manche kann er sogar selbst schon wiedererkennen, zum Beispiel ALDI und ARAL und McDonald’s.
Aber die Schule ist dann doch nicht so schön. Auch wenn seine Lehrerin ziemlich lieb ist, muss er immer zu lange stillsitzen, und wenn er anfängt, sich zu langweilen und herum zu wuseln, ruft sie ihn zur Ordnung. Es ist nicht wie zu Hause, wo man im Fernseher den Sender wegzappen kann, wenn einen die Bilder nicht mehr interessieren, oder das Konsolenspiel abbrechen und ein neues starten, wenn man sauer ist, weil alles so schwierig wird.
Auch wenn es schwierig wird oder langweilig ist, soll Justin in der Schule plötzlich versuchen, sich zu konzentrieren. Und es wird auch so furchtbar viel geredet, und Justin versteht längst nicht alles: nicht alle Wörter und nicht alle langen, schwierigen Sätze.
Lesen lernen wird zum Frust
Und dann das Lesen lernen! Das Lesen will und will nicht klappen, und eigentlich ist das gar nicht überraschend. Für das Lesen nämlich, ist unser Gehirn ursprünglich nicht gedacht. Unsere Vorfahren, die in ihren Steinzeithöhlen mit Genuss verkokelte Keulen abgenagt und sich gegenseitig die Läusenissen aus den Haaren gepflückt haben, deren Genom aber trotz aller Fremdheit schon haargenau so aussah wie unser Genom heute, hatten keinerlei Interesse an Lektüre, welcher Art auch immer.
Sie mussten schließlich auch nicht lesen können, dafür war gar keine Zeit, wenn immer rechtzeitig genügend Nahrung für die Sippe beschafft und fiese feindliche Sippen vertrieben werden sollten. In ihrem Gehirn war daher ein speziell für das Lesen gedachter Bereich vollkommen überflüssig, und darum fehlt er uns auch heute noch.
Als die Menschen dann damit begannen, sich durch verschiedenste Arten von Schrift zu verständigen (Keilschrift, Hieroglyphen, schließlich unsere Buchstabenschrift), funktionierten sie einfach mehrere ursprünglich für andere Zwecke gedachte Hirnareale für diesen Zweck um. Sie kombinierten und koordinierten diese Hirnareale miteinander, nutzten vor allem den für das Spurenlesen gedachten Bereich – aber bis heute tut sich unser Gehirn mit dieser Zweckentfremdung schwer, und jedes Kind merkt das schmerzlich aufs Neue, wenn es lesen lernt.
Lesen lernt man nicht quasi biologisch vorprogrammiert wie Sprechen, Krabbeln oder Laufen – in unserer Entwicklung ist es eigentlich gar nicht vorgesehen.
Mit dem Lesen und Schreiben überschreitet der Mensch sein biologisches Ich.
Das merkt jetzt auch Justin. So viele schwierige Zeichen, die man alle auseinanderhalten muss und die alle etwas anderes bedeuten, was Justin sich zuerst nicht merken kann! Was hat das A, z. B., das komische Zeichen, das doch aussieht wie ein Zelt, mit einem Apfel zu tun? Und H, das aussieht wie ein verrutschtes Tor, mit einem Haus? Ist das nicht alles sehr unlogisch? Das will nicht in Justins Kopf.
Und dann soll man diese komischen Zeichen auch noch zusammenziehen, A-P-F-E-L, das heißt dann Apfel, aber wenn Justin mit dem Zusammenziehen beim L angekommen ist, hat er das A längst vergessen. Und weil Justin ja nicht so schrecklich viele Wörter kennt – sie sind ja keine Quasselfamilie! – hilft es ihm auch nicht, wenn er den ersten Buchstaben erkennt, immer muss er das ganze Wort zusammenziehen.
Warum Justin in Büchern nichts findet
Manche Kinder können immer schon beim ersten oder zweiten Buchstaben raten, wie das ganze Wort heißt, einfach, weil sie den Satz im Kopf haben und wissen, was da jetzt passt, die müssen sich gar nicht so anstrengen. Aber erstens hat Justin nicht den ganzen Satz im Kopf, er muss sich so auf das Buchstaben-Zusammenziehen konzentrieren, dass er sich den nicht merken kann; und zweitens kennt er nicht so viele Wörter, dass ihm das passende so schnell einfallen würde.
Und am Allerschlimmsten ist es, wenn man ganz viele solcher Wörter hinter einander buchstabieren muss, ganze Sätze, vielleicht sogar mehrere: Selbst wenn Justin das hinkriegt und alles ganz richtig, nur vielleicht ein bisschen langsam vorliest, ist die Lehrerin immer noch nicht zufrieden und fragt hinterher auch noch, was denn da in der Geschichte steht, die er eben vorgelesen hat: Und wie soll Justin das denn wohl wissen, wo er sich doch so darauf konzentrieren musste, die Buchstaben zu erkennen und dann auch noch zusammen zu ziehen? Da war wirklich keine Zeit, auch noch rauszukriegen, was das Ganze bedeutet.
Und dann, so ungefähr in der dritten Klasse, sollen sie auch noch ganze Bücher lesen! Wenn Justin all die Wörter und die Sätze zusammenziehen soll, ist das schrecklich anstrengend, und wieso die Lehrerin glaubt, es könnte Spaß machen, hat er keine Ahnung. Wo ihm doch noch nicht mal Vorlesen Spaß macht!
(Manchen in der Klasse macht es aber Spaß, das ist merkwürdig. Justin entwickelt einen ersten kleinen Zorn auf Bücher, weil er durch sie so dumm dasteht, und das fühlt sich nicht gut an. Justin beschließt, dass er den Mist gar nicht können will, die richtig Coolen in seiner Klasse finden Lesen auch alle Mist. Bücher sind einfach nicht cool. Später wird Justin sagen: Bücher sind peinlich.)
Wenn Lesen schwerfällt, leidet das Selbstbewusstsein
Wie Justins Geschichte weitergeht, ist klar. In den folgenden Jahren wird ihm in der Schule in allen Fächern seine schwache Lesefähigkeit zu schaffen machen. Überall wird ja vorausgesetzt, dass er Texte schnell sinnentnehmend lesen kann, das ist die Voraussetzung, um sich mit den Inhalten überhaupt auseinandersetzen zu können. In Mathe hat Justin Probleme mit den Textaufgaben – nicht, weil er nicht rechnen kann, einfach nur, weil er nicht versteht, was er überhaupt rechnen soll. In Sachkunde weiß er nicht, wovon die Rede ist, oder immer nur ein bisschen. Und Deutsch ist überhaupt Mist. Und wenn Justin schreiben soll – und das soll er in allen Fächern! – kann er sich dabei einen ganzen Satz immer nur schwer merken. Am Ende weiß er schon nicht mehr richtig, was seine ersten Wörter waren. Darum schreibt Justin nur kurze Sätze. Und kurze Texte. Selbst wenn er vielleicht zu einem Thema ganz viel weiß, schreibt Justin nur wenig, und wie viel er weiß, kriegt der Lehrer dann leider nicht mit. Über Justins Rechtschreibung wollen wir nicht reden.
Auf der Suche nach Anerkennung
Wenn Justin die Schule verlässt – hoffentlich wenigstens mit einem Hauptschulabschluss! –, hat er viele Jahre lang die Erfahrung gemacht, dass er den Erwartungen, die an ihn gestellt werden, nie so ganz entsprechen kann. Für sein Selbstbewusstsein ist das nicht so toll gewesen. Justin möchte sich aber gerne auch toll fühlen. Justin möchte auch endlich mal das Gefühl haben, dass er großartig ist, besser als andere, dass er bewundert wird. Justin entscheidet, dass dieser ganze Bildungs-Scheiß nur etwas für Idioten ist, sonst würde er sich doch dafür interessieren und damit klarkommen, und seine Kumpels auch. Justin sucht sich lieber andere Gebiete, auf denen er sich großartig fühlen kann, Gruppen, die ihm sagen, dass er toller ist als andere – welche Gruppen das sein könnten, vielleicht sogar abhängig davon, ob Justin Justin heißt oder Recep oder Wladimir, könnt ihr euch ausmalen. Das Bild ist nicht schön.
Alles nur platte Klischees?
Vielleicht denkt ihr jetzt, ich bediente hier platteste Klischees – aber wer viel in bestimmten Stadtteilen unterwegs ist, wer dort als Lehrerin oder Lehrer arbeitet, wer mit den sozialen Diensten zu tun hat, der weiß: Kinder wie Justin gibt es Millionen in Deutschland, die können auch Recep heißen oder Wladimir. Ihre Eltern haben ihr Kind genauso lieb wie die Eltern in Hamburger Ortsteilen wie Eppendorf oder Othmarschen, in Volksdorf oder Winterhude, und sie tun, was sie für das Beste halten.
Das Traurige ist, dass sie es eben oft nicht besser wissen, und dass die Bewältigung ihres eigenen Lebens – z. B. bei Alleinerziehenden, Migranten, Langzeitarbeitslosen – sie oft so sehr überfordert, dass für aufwändiges Nachdenken, womöglich „Nachlesen“ über die beste Art der Kindererziehung einfach keine psychische Kraft mehr übrig ist.
Heinrich – von Anfang an in Geschichten zu Hause
Heinrich – er könnte aber auch Konrad heißen oder Wilhelm oder Friedrich. Auch Heinrich wird in eine Familie hineingeboren, die ihn sehr liebhat. Dieses Mal in eine, bei der es Bücherregale gibt. Schon als Heinrich noch sehr klein ist, sieht er manchmal seine Mama und seinen Papa stundenlang in eins von diesen eckigen Dingern gucken, deren Reiz sich ihm beim besten Willen nicht erschließen will. Sie sitzen einfach nur ganz still, und wenn Heinrich dann mit ihnen spielen will, sagen sie „pssst!“. Diesen Dingern muss ein Geheimnis innewohnen, das ahnt Heinrich schon früh, und eines Tages muss es sich auch ihm erschließen.
Die ersten Bilderbücher auf Mamas Schoß
Dass auf der glänzenden grauen Fläche Bilder erscheinen können, erfährt Heinrich erst mit, sagen wir drei Jahren. Dann darf er einmal in der Woche gemeinsam mit Mama oder Papa eine halbe Stunde lang sehen, was da los ist, das ist toll. Aber schon viel früher, als Heinrich ein Jahr alt ist, sitzt er jeden Abend lange auf Mamas oder Papas Schoß und guckt mit ihnen Bilderbücher an. Zu Anfang guckt er vielleicht noch gar nicht so viel: Stattdessen beißt er in die Pappseiten und pfeffert das Buch in die Ecke und versucht mit seinen kleinen Händen hin und her zu blättern, wie Mama und Papa es bei den großen eckigen Dingern tun.
Aber allmählich versteht Heinrich, dass es gar nicht um das Ding selbst geht, sondern um das, was auf seinen Seiten zu sehen ist. „Guck mal, ein Hund!“, sagt Papa. „Guck mal ein Apfel!“ Und wenn Heinrich dann in den Apfel beißen will, schmeckt der nicht nach Apfel und fühlt sich nicht wie ein Apfel an, und Heinrich versteht langsam, ganz langsam, dass die Dinge in den Bilderbüchern keine echten Dinge sind, sondern nur Bilder von echten Dingen. Und damit erlebt er zum ersten Mal, dass es zusätzlich zu der wirklichen Welt, in der er mit Mama und Papa und anderen Leuten und Hunden und Äpfeln lebt, noch eine weitere Welt gibt, die ist nicht echt, und die steckt in den Büchern.
Gefühle stecken an, indem man sie in Geschichten erlebt
Als Heinrich zwei Jahre alt ist, begreift er allmählich auch, dass in den Büchern diese zweite Welt nicht nur in Bildern versteckt ist, sondern auch in Wörtern. „Happy, das kleine Nilpferd war traurig“, liest Mama vor und Heinrich guckt auf die Seite, auf der einem kleinen Nilpferd die Tränen nur so über die dicken Wangen kullern. Da kullern sie bei Heinrich auch und Mama sagt, dass ihr kleiner Heinrich doch nicht weinen muss und dass das doch alles nur ausgedacht ist; und Heinrich versteht noch besser, dass die Welt in den Büchern nicht echt ist. Und dann kuscheln sie sich gemütlich aneinander, und Heinrich weiß immer besser, dass diese Bücher wirklich etwas Schönes sind – weil die Zeit auf Mamas und Papas Schoß mit den Büchern so schön ist. Und wenn ein kleines Nilpferd am Anfang der Geschichte traurig war, dann ist es an ihrem Ende bestimmt wieder froh, und wie es dazu gekommen ist, genau das erzählt die Geschichte. Da wird Heinrich jeden Tag ein kleines bisschen überzeugter, dass alle Geschichten immer gut ausgehen und dass es darum doch wohl im richtigen Leben eigentlich auch so sein muss. Alles wird am Ende immer gut, das ist tröstlich und man muss keine Angst haben.
Der große Schatz: Wörter und Sätze, die schon vertraut sind
Wenn Heinrich in die Kita geht, werden auch da Bilderbücher vorgelesen. Man darf sie sich auch aus einer Bilderbuchkrippe nehmen und sich ganz allein mit einem Buch in eine Ecke zurückziehen, zum Beispiel, wenn es einem sonst im Gruppenraum zu laut wird. Dann kann man einfach in dem Bilderbuch verschwinden, in der zweiten Welt.
Manchmal muss Heinrich sich mit seinen Kumpels um ein Bilderbuch streiten, zum Beispiel um das Buch mit den Müllautos, den Baggern und den Feuerwehren. Bücher sind etwas Gutes.
Und zu Hause oder wenn sie Auto fahren, erzählen Mama und Papa Heinrich jetzt manchmal auch einfach nur Geschichten, ganz ohne Bilder. Oder er darf Hörbücher hören, wenn Mama und Papa leider keine Zeit für ihn haben. Dann liegt Heinrich auf dem Fußboden mit dem Ohr ganz dicht am Lautsprecher und hört, wie die böse Königin Schneewittchen umbringen lassen will, das ist schrecklich; aber Heinrich weiß ja, dass in Geschichten am Ende immer alles gut wird, darum hält er das aus. So schön wie vorgelesen kriegen sind Hörbücher natürlich nicht, es fehlt die Kuscheligkeit auf Mamas oder Papas Schoß, aber irgendwie steckt die Kuscheligkeit jetzt sowieso ganz von alleine in den Geschichten drin, Heinrich weiß ja, dass sie dazu gehört.
Lesen wird leichter – und macht Spaß
Wie Justin wartet Heinrich sehnsüchtig auf die Schule. Ein paar Wörter erkennt er ja schon, ALDI und ARAL, vielleicht „nicht“ McDonald’s; und ein paar Buchstaben kennt Heinrich auch, mit denen hat er selbst schon Wörter gebastelt – F-A-T-A (Vater) und F-G-L (Vogel), z. B. Und Mama und Papa waren ganz aufgeregt. Natürlich ist es anstrengend, sich all die vielen Buchstaben zu merken, und die langen Wörter zusammen zu ziehen ist auch nicht immer leicht: Aber zum Glück kennt Heinrich aus den Geschichten ja viele lange Sätze und viele, viele Wörter, da kann er ganz oft raten, welches Wort gemeint ist, wenn er nur den ersten oder auch noch den zweiten und vielleicht dritten Buchstaben sieht. Mit Raten geht das Lesen viel schneller und nach einer Weile geht es sogar so leicht, dass Heinrich gar nicht mehr über das Buchstabenzusammenziehen nachdenken muss oder am Schluss des Satzes darüber, was wohl das erste Wort war: Das weiß sein Kopf plötzlich ganz von allein, weil er sich um diese ganze Buchstabensache nicht mehr so kümmern muss. Darum kann Heinrich der Lehrerin jetzt auch immer sagen, was er gelesen hat, das kriegt er jetzt mit.
Sprache als Werkzeug: Probleme mit Worten lösen
Wie Heinrichs Geschichte in den folgenden Schuljahren weitergeht, ist klar. Dass er so gut lesen kann und es auch noch gerne tut, hilft ihm überall und wenn Heinrich etwas weiß, schreibt er es alles ganz genau auf, damit der Lehrer auch wirklich mitkriegt, wie viel er weiß.
Bestimmt ist Heinrich manchmal faul und manche Fächer mag er nicht und manche Lehrer auch nicht, da ist er dann nicht so gut. Trotzdem mache ich mir um Heinrichs schulische Zukunft keine ernsthaften Sorgen. Heinrich hat ein ziemlich stabiles Fundament, da wird alles andere schon kommen.
Und dass durch die vielen Bücher Sprache für Heinrich zu einem Instrument geworden ist, mit dem er gerne und souverän umgeht, spielt nicht nur in der Schule eine Rolle. Schon immer haben seine Eltern und die Erzieherinnen in der Kita ja gesagt, dass man alle Probleme mit Worten regeln kann; und je älter Heinrich wird, desto mehr begreift er, was sie damit meinen.
Was Lesen im Kopf bewirkt
Natürlich muss Heinrich sich trotzdem noch manchmal mit einem Freund prügeln, aber über ganz viele Dinge kann man sich doch mit Worten streiten und hin und her Argumente austauschen, das ist auch weniger gefährlich für die Gesundheit und das klappt oft sogar dann, wenn man furchtbar wütend ist.
Justin dagegen muss ständig das Risiko eines gebrochenen Nasenbeins eingehen: Wenn er wütend ist, ist er eben wütend, dann schlägt er zu. Dass man solche Dinge auch mit Wörtern regeln könnte, hat er schon in der Grundschule nicht verstanden, so gerne redet er schließlich nicht, da geht prügeln viel schneller. Viel Hin- und Hergerede macht Justin nur noch wütender. Da fühlt er sich nämlich wieder blöde, und dann schlägt er noch härter zu.
Und noch etwas erlebt Heinrich anders als Justin.
„Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“,
formulierte einst Ludwig Wittgenstein. Stellen wir uns einen Menschen vor, der nur die Farbwörter blau und grün kennt, nicht aber türkis: Sobald er einen Gegenstand in türkis sieht, wird der dessen Farbe als (sehr grünliches) Blau bzw. als (sehr bläuliches) Grün wahrnehmen. Solange es keinen Begriff für Türkis gibt, gibt es für ihn auch Türkis als Farbe nicht. – Ganz anders ein Mensch, in dessen Sprache es vielleicht nicht nur wie bei uns ein Wort, sondern drei Wörter für diesen Bereich des Farbspektrums gibt: Er wird nicht nur exakt sagen können, um genau welches Türkis es sich jeweils handelt, er wird das Farbspektrum auch automatisch differenzierter wahrnehmen als wir.
„Wovon wir nicht reden können, darüber müssen wir schweigen“,
auch das hat Wittgenstein gesagt. Und wenn ich für etwas keinen Begriff habe, dann fällt mir die Wahrnehmung schwer. Während das im Bezug auf das Farbspektrum vielleicht noch eine Lappalie ist (vielleicht nicht für Illustratoren!), spielt die Internalisierung einer Fülle von Begriffen für das Spektrum unserer Gefühle eine große Rolle.
Für Heinrich ist das kein Problem, er ist in seinen Geschichten immerzu so vielen Gefühlen begegnet! „Die Königin war traurig; da wurde der König rot vor Zorn; die Verzweiflung verschlug dem kleinen Drachen den Atem“: Ein Gefühl, das ihn umtreibt, wird er benennen und sich so aktiv mit ihm auseinandersetzen können. Denn was ich auf den Begriff bringen kann, das kann ich genauer betrachten, ich kann es bearbeiten.
Gefühle benennen heißt: Gefühle begreifen
Ein Mensch, der seine Gefühle nur fühlt, ohne einen Namen für sie zu wissen, ist dem brodelnden Chaos ausgeliefert. Erst wenn ich sie auf den Begriff bringen kann, kann ich bewusster mit ihnen umgehen, dann sind sie beherrschbarer.
Etwas sehr Erstaunliches passiert Heinrich übrigens eines Tages irgendwann, als er so gut lesen kann, dass sein Kopf weiß, was er liest: Plötzlich ist er selbst beim Lesen genauso aufgeregt, traurig, ängstlich oder froh wie die Personen in der Geschichte. Dabei passiert ihm doch gar nichts! Dabei liegt er doch nur ganz friedlich am Strand oder sitzt auf dem Bett in seinem Zimmer. Aber die Gefühle sind da, und darum muss Heinrich weiterlesen und weiterlesen.
Warum Bücher tiefer wirken als Filme
Und wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ja nun, aber ich durchlebe doch auch beim Betrachten eines Films zum Teil sehr intensive Emotionen, dann ist das sicher richtig, gerade der Film lebt ja davon, dass er allerstärkste Gefühle auslöst: Und trotzdem ist etwas daran ganz anders als beim Lesen, und weil das so wichtig ist, will ich es noch ein bisschen genauer ausführen.
Die Figuren in einem Film nämlich, selbst wenn ich mich mit ihnen identifiziere (und was genau das ist, „identifizieren“, kann bis heute niemand so genau sagen), sind immer fertige Menschen, denen ich mich gegenübersehe wie den wirklichen Menschen im wirklichen Leben. Im Buch dagegen stoße ich nur auf kleine schwarze Zeichen auf weißem Papier – und wenn daraus in meinem Kopf lebendige Vorstellungen werden sollen – eben das, was bei Justin nicht so richtig klappen will – dann geht das nur, wenn ich mit meinem eigenen Gedanken-, Erfahrungs- und Erinnerungsmaterial arbeite, die Geschichte damit quasi überhaupt erst konkretisiere, sonst bleiben die Zeichen nur Zeichen und die Wörter nur Wörter, wie es bei Justin passiert.
Zu dem Wort „Küche“ zum Beispiel hat Astrid Lindgren geschrieben, dass in ihrem Kopf immer, egal in welcher Geschichte, für Sekundenbruchteile eine bestimmte Küche aus ihrer Kindheit auftauche. Erst dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es bei mir ähnlich ist – nur sind es bei mir drei Küchen, je nach Kontext. Aber meine drei Küchen sind natürlich andere als die Küche, die in Astrid Lindgrens Kopf für Millisekunden aufschien während der Lektüre eines Buches, wenn auch fast nicht bewusst. Und eure Küchen werden wieder andere sein.
Noch spannender wird es, wenn es um Personen geht: Wenn wir von einem Vater lesen, werden unsere ersten Assoziationen vermutlich auf unseren bei uns allen vollkommen unterschiedlichen Erfahrungen mit unseren eigenen Vätern basieren, werden wieder im Millisekunden-Umfang begleitet sein von den Gefühlen, die diese Erinnerungen bei uns auslösen. In jedem Kopf entsteht so bei der Lektüre ein ganz eigenes, jeweils unterschiedliches Buch des Lesers, auch wenn alle Leser materiell haargenau denselben Text in der Hand halten:
Der Text eines Buches ist immer mindestens ebenso sehr der Text des Lesers wie der des Autors.
Lesen als Begegnung mit dem eigenen Ich
Wenn aber der Text eines Buches in jedem Kopf ein konkret und emotional anderer ist, weil er ausschließlich aus dem Erfahrungsmaterial des Lesers besteht, dann bedeutet das auch: Beim Lesen setze ich mich immer und jedes Mal, wenn auch unbewusst und ungesteuert, mit mir selbst, mit meinem eigenen Leben, auseinander, selbst wenn ich über Abenteuer im Weltall, in der Zauberwelt von Hogwarts oder in Panem lese. Darum ist Lesen jedes Mal, das behaupte ich einfach, wie eine kleine Psychotherapie. Darum auch hat der Leser, der sich wie Heinrich nicht mehr auf den technischen Lektüreprozess konzentrieren muss, das Gefühl, dass es in dem Buch irgendwie um ihn selbst geht, und tatsächlich stimmt das ja auch: Ich bin das, ich!, der da über die Prärie reitet, schwedische Verbrecher jagt oder finstere Wissenschaftler in Höhlen unter der Irischen See.
„Lesen“, sagt der amerikanische Autor und Journalist James Carroll, „ist schlicht und einfach ein introspektiver Akt. Es geht nicht nur um die bloße Aufnahme von Informationen. Vielmehr ist Lesen eine Begegnung mit dem Ich.“
In der Fachwelt gibt es dafür den Begriff des „deep reading“, zu dem der Leser erst nach dem Erreichen einer bestimmten Stufe der Lesefähigkeit in der Lage ist. Indem ich in die fremde Welt des Buches eintauche, tauche ich immer auch ein in mein eigenes Ich, anders wäre die Welt des Buches gar nicht zu erleben. Und das Wunderbare daran ist: Mit großer Intensität kann der Leser in der Haut seines Helden alle möglichen Lebenssituationen, Erfahrungen, Entscheidungen quasi probeweise durchspielen – vollkommen gefahr- und risikolos: So also fühlt es sich an, wenn dies geschieht, wenn ich jenes tue, wenn ich mich so oder so entscheide. Dass diese Vorab-Erfahrung in schwierigen Situationen hilft, erscheint mir selbstverständlich.
Mehr Erfahrungen, mehr Frustrationstoleranz
So sind in Heinrichs Kopf für jede zu treffende Entscheidung viel mehr Erfahrungen gespeichert, als er sie im realen Leben gemacht hat, noch dazu mit den dazugehörigen gefühlsmäßigen Auswirkungen. Auch Krisen kann Heinrich so besser durchstehen – und das kann er außerdem auch deshalb, weil bei ihm die Hoffnung, dass am Ende alles gut werden wird, schon fast eine Überzeugung ist. Das nämlich ist ein immer wieder verstärktes Muster in seinem Kopf seit der Pappbilderbuchzeit: Egal, wie traurig das kleine Nilpferd am Anfang ist, am Ende ist es wieder froh. Egal, wie gemein alle am Anfang zu Harry Potter sind, am Ende ist er der tollste Zauberer von allen.
Durch all dies ist Heinrich für sein Leben besser gerüstet. Und wenn es ihm im wirklichen Leben einmal schlecht geht auf eine Weise, an der er wirklich nichts ändern kann – und auch Heinrich wird das passieren wie uns allen: Dann kann er sich zwischendurch immer in die zweite Welt flüchten und in ihr leben, um sich Trost spenden zu lassen, und bleibt dabei trotzdem bei sich. Das, was uns im wirklichen Leben fehlt, wonach wir uns sehnen, können wir uns durch Bücher mit enormer Intensität ersetzen lassen.
Die Autorin und Kollegin Cornelia Funke hat auf den Vorwurf hin, lesen wäre doch eigentlich eine Flucht aus dem Leben, gefragt, wer denn wohl etwas gegen eine Flucht haben sollte, außer dem Kerkermeister. So sehr mir dieser Satz gefällt: Er greift ja noch viel zu kurz. Lesen ist nämlich in Wirklichkeit alles andere als Flucht, Lesen ist Entdeckung.
Wenn ein Kind beim Lesen in einer Geschichte lebt, wird sie zu einer Erweiterung und Vertiefung seines eigenen Lebens und seines eigenen Ich.
Noch etwas übrigens hat Heinrich ganz beiläufig durch seine umfangreiche Lektüre gelernt. Da Geschichten in der Regel bestimmten Mustern folgen – von denen es natürlich eine Vielzahl gibt, Krimi, Liebesgeschichte, Fantasy, Science Fiction – hat Heinrich im Laufe der Zeit innere Schemata entwickelt, mit denen er den Anfang einer Geschichte abgleicht und so Vermutungen für deren weiteren Fortgang treffen kann.
Angefangen hat das schon früh mit der Kenntnis der Märchen und ihrem Handlungsbogen von: „Es war einmal“ bis: „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute“. Diese Form der Antizipation erleichtert das Lesen nicht nur, sie macht es auch spannender. Wenn ein Charakter am Anfang hämisch grinst, wird der erfahrene Leser, selbst wenn dieser Mensch danach ständig kleinen Kindern freundlich über die blonden Lockenköpfe streichelt, schon vermuten, dass er sich noch als ganz übler Kerl erweisen wird. Und weil die gelernten Muster und Schemata in seinem Kopf ihm schon früh erlauben, Spekulationen über den weiteren Verlauf anzustellen, erhöht sich Heinrichs Frustrationstoleranz: Anstatt genervt zu sein, dass im Kriminalroman der Täter auch auf Seite 500 noch immer nicht gefunden worden ist, steigert das für ihn nur die Spannung, weil er Hinweis für Hinweis zusammensetzt. Nicht ausgeschlossen – sogar ziemlich wahrscheinlich – dass auch diese gelernte Frustrationstoleranz, die ich beim Lesen immer brauche, trainiert und auf das eigene Leben übertragen wird und dass sie Heinrich nützt.
Muster aus Geschichten – Chancen und Risiken
Die Muster und Schemata aus den Büchern jedenfalls überträgt der Leser auf sein reales Leben.
Wir alle denken in Schemata, Schemata bringen Ordnung ins Chaos der unendlichen Informationsfülle unseres Lebens und wir müssen nicht immer wieder und in jeder Situation jede Einzelheit neu bewerten. Allerdings können die Verwendung von Schemata allgemein (z. B. bei Klischees) und auch die Übertragung von Mustern aus Büchern manchmal ganz enorm daneben gehen, das sollte fairerweise noch gesagt werden. Wenn sich im Märchen der Prinz regelmäßig für das Aschenputtel entscheidet und im Heftroman der reichste, schönste, adeligste Arzt im teuersten SUV immer für das ärmste, unscheinbarste Mädchen, dann ist Vorsicht geboten. Dann ist das ein Muster, auf das im wirklichen Leben zu setzen wir jungen Frauen nicht unbedingt empfehlen sollten.
Bücher vermitteln Haltungen und Erfahrungen, Bücher führen mich näher an mein eigenes Ich.
Bücher machen empathischer
Aber, und darüber muss zum Schluss unbedingt noch gesprochen werden, sie führen mich auch näher an das Ich des anderen. Denn Bücher, auch das behaupte ich sehr energisch, steigern die Empathie, und genau das ist etwas, was in unserer Gesellschaft dringend nötig ist.
Dass z. B. ein Ego-Shooterspiel das gar nicht leisten darf, ist klar: In den Gegner fühle ich mich im Spiel immer gerade nur so weit ein, wie es nötig ist, um seinen nächsten Schachzug vorhersagen und seiner nächsten Kugel, seinem nächsten Schwerthieb ausweichen zu können. Wie es in ihm aussieht, was er fühlt und fürchtet, vermittelt das Spiel mir nicht, das wäre ja auch kontraproduktiv: Sobald ich meinen Gegner als fühlendes Wesen wahrnehmen müsste, würde es mir vielleicht nicht mehr ganz so leichtfallen, ihn möglichst zügig umzubringen.
Und in Filmen kann ich natürlich auch mit den Figuren mitfühlen. Aber, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, nur auf haargenau dieselbe Weise, auf die es mir auch im realen Leben möglich ist: Ich sehe einen Menschen von außen, sehe seine Mimik, seine Gestik, höre seine Worte, weiß vielleicht noch etwas über seine Lebenssituation und schließe daraus auf seine Gefühlswelt. Aber wirklich in seinen Kopf hineingucken kann ich nicht.
Genau das aber kann ich in Büchern – und nur in Büchern. Wie mein Held sich fühlt, welche Hoffnungen, Sehnsüchte, Wünsche ihn umtreiben, genau das wird mir im Buch aus der Innensicht erzählt. Je mehr Bücher ich lese, in desto mehr Köpfen bin ich also unterwegs gewesen, nicht mehr nur, wie der arme Justin, in meinem eigenen Kopf. Und diese differenzierte Kenntnis der Gefühle anderer macht es mir zunehmend leichter, mich auch in jeder realen Situation in mein Gegenüber hinein zu versetzen.
Empathie ist eine unglaublich kostbare und wichtige Fähigkeit im Leben jedes einzelnen Menschen – und entscheidend wichtig für die Gesellschaft insgesamt.
Schlagen Justin und seine Kumpel vielleicht nicht nur deshalb so schnell und heftig zu, weil ihnen die Sprache für eine verbale Auseinandersetzung fehlt, sondern auch, weil es ihnen sehr, sehr schwerfällt, sich überhaupt in den anderen einzufühlen? Wie sehr nehmen sie ihn überhaupt als fühlendes Wesen, wie sie selber es sind, wahr?
Ich will nicht zu kühn werden mit meinen Spekulationen. Aber dass der regelmäßige Aufenthalt in den fremden Köpfen von Buchfiguren, die doch überhaupt nur lebendig werden, weil ich ihnen meine eigenen Gefühle leihe, Leser empathischer macht, erscheint mir nur logisch. Zudem wird es durch Beobachtungen in der Wirklichkeit ja häufig bestätigt. Auch Empathie ist vielleicht zum Teil einfach eine Sache des Trainings.
„Lesen können“ kann die Welt verändern
Noch gar nicht gesprochen habe ich, wie wir das vor einiger Zeit sicher vor allem getan hätten, über Inhalte: Wenn Bücher Haltungen, Überzeugungen vermitteln können, können sie dann nicht auch die Welt verändern? Ein beliebtes und viel zitiertes Beispiel ist Harriet Beecher-Stowes „Onkel Toms Hütte“, das 1851 erschien und nachweislich den Abolitionisten in den USA den Weg ebnete. Und viele Menschen meiner Generation haben eine zunächst einmal grundsätzlich pazifistische Haltung durch Remarques „Im Westen nichts Neues“ gelernt, und für die 68er hatte die Lektüre von Bertolt Brecht zum Teil den Charakter eines Erweckungserlebnisses.
Warum jedes Kind eine zweite Welt braucht
Unsere Schulen bemühen sich ohne Ende auch in Stadtteilen, in denen Kinder wie Justin, Recep und Wladimir in der Mehrzahl sind, Freude am Lesen zu wecken – aber ihre Karten sind nicht gut und so viel Zeit steht ihnen dafür, bei der zunehmenden Fülle der Aufgaben, deren Erfüllung wir inzwischen von unseren Lehrern verlangen, auch einfach nicht zur Verfügung. Kinder, die bei der Einschulung eine reiche Medienerfahrung besitzen, aber noch nie ein Buch in der Hand hatten oder vorgelesen bekommen haben, zu begeisterten Lesern zu machen, erscheint mir nach mehreren Jahrzehnten, in denen ich viele Schulen und großartige Lehrer bei ihren Versuchen kontinuierlich begleitet habe, fast so schwierig wie die Quadratur des Kreises.
Vielleicht können Bücher nicht die Welt retten, auch wenn es viele Beispiele dafür gibt, wie Literatur der Wirklichkeit, manchmal auch nur sehr vermittelt, einen Schubs in eine neue Richtung gegeben hat.
Ein Plädoyer für Bücher als Lebensgrundlage
Aber ich bin überzeugt, dass ein Kind, das liest, es nicht nur leichter hat und sogar klüger wird, sondern dass es auch mehr bei sich selbst, einfühlsamer und glücklicher ist, als es das ohne Bücher wäre. Und auch für uns alle, für die Gesellschaft insgesamt, ist ein solches Kind ein Glücksfall.
von Kirsten Boie
Quelle: Auszug aus dem Vortrag „Über die Entwicklung der Lesefreude“, gehalten zum 60. Jubiläum der Bödecker-Kreise, Hannover 2014
Links zum Thema
Kinderbücher als wertvolle Begleiter
Geschichten für Kinder
Wenn Realität und Fantasie zu sehr verschwimmen
Wenn das Smartphone die Nähe stört
Stöbern Sie in unseren Leseempfehlungen und Rezensionen.