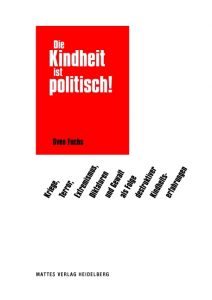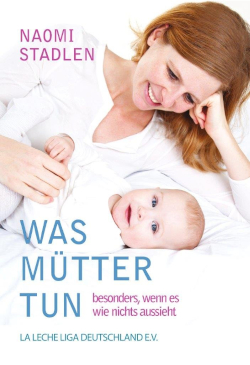Die große Sehnsucht der meisten Menschen ist das friedliche Zusammenleben. Es gelingt jedoch in weiten Teilen der Welt immer noch nicht und die Unfähigkeit zum Frieden erreichte in der Vergangenheit besonders in Europa verheerende Ausmaße. Die Friedensforschung sucht unablässig nach Ursachen dafür – ohne das Wesentliche zu erkennen. Nun hat der Gewaltforscher und Psychohistoriker Sven Fuchs ein Buch vorgelegt, mit dem er diesem Problem auf den Grund geht.
Erschreckende aber zutreffende These
Mit „Die Kindheit ist politisch – Kriege, Terror, Extremismus, Diktaturen und Gewalt als Folge destruktiver Kindheitserfahrungen“ zeigt er eindringlich, wie in der Vergangenheit kriegerische Auseinandersetzungen zustande kamen und wie es auch heute noch in der ganzen Welt zu Krieg und Terror kommt.
Der Komplexität des Themas wird der Autor gerecht, indem er eine große Anzahl historischer und zeitgenössischer Quellen und Biografien analysiert, um seine erschreckende und doch zutreffende These zu belegen. Dabei weist er wiederholt darauf hin, dass nicht jede destruktive Kindheitserfahrung zu Terror und Gewalt führt – jeder Diktator, Extremist oder Kriegstreiber jedoch eine unzuträgliche Kindheit hatte. Psychoanalytiker bestätigen, dass solche Kindheitserfahrungen nicht spurlos an den Menschen vorübergehen.
Der Autor beschreibt das auf S. 343 so: „Gesellschaften, die einen Anteil von 30 % in der Bevölkerung von als Kind schwer misshandelten Menschen haben, führen nicht automatisch Kriege, diese Gesellschaften werden aber deutliche soziale, politische und ökonomische Problemlagen aufweisen.“ Solche Problemlagen können wir auch noch in Europa feststellen, so dass sich die Frage stellt, wie viele Kinder heute wirklich ohne körperliche und seelische Gewalt aufwachsen. Besonders unsere globale Gesellschaft erfordert die Beschäftigung mit dem Thema, denn dieser destruktive Umgang mit den Kindern steckt auch hinter den weltweiten Flüchtlingsbewegungen.
Die Auswirkungen belasteter Kindheit
Wie solche Kindheitserfahrung im Einzelnen wirken, zeigt Sven Fuchs an ganz verschiedenen Bevölkerungsgruppen, an unterschiedlichen Täterschaften, an parteipolitischen Ausrichtungen und am gesellschaftlichen Ausblenden der Auswirkungen von Kindesmisshandlungen unerwartet erhellend auf. Herangezogene wissenschaftliche Studien bestätigen seine Ausführungen. Die eigene Betroffenheit über das beschriebene Leid der Kinder, das zugleich nicht die daraus entstandenen Katastrophen entschuldigt, wird formuliert und ist beim Lesen immer wieder spürbar.
Der Kindheit Hitlers und seiner Gefolgsleute ist ein besonderes Kapitel gewidmet. Die Kindheitserlebnisse dieser Männer der NS-Machtelite haben zusammen mit der damals vorherrschenden autoritären und gewaltsamen Erziehung zur größten menschengemachten Katastrophe geführt. Die ganze Tragweite wird deutlich durch die Beschreibung der Kindheiten von sechszehn dieser Gefolgsmänner – als herausragende Beispiele gestörter Kindheitsentwicklungen in jener Zeit – die eine Unausweichlichkeit dieser unfassbaren Entwicklung nahelegen. Auch wenn bereits Joachim Fest 1963 über ‚Das Gesicht des Dritten Reiches‘ diesen Zusammenhang hergestellte, wundert es doch, wie lange die jetzt vorliegende umfassende Aufarbeitung gebraucht hat.
Kindheitsgeschichte als wichtiger Bestandteil des Unterrichts und des politischen Diskurses
In den Geschichtsunterricht der Oberstufen sollte dieser Hintergrund bei der Behandlung des Völkermordes an den europäischen Juden und des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges aufgenommen werden. Schüler:innen würden sich damit ein umfassendes verständnisförderndes Wissen aneignen, das im Weiteren auch einen Bezug zum meistens privilegierten eigenen Leben herstellt und gleichzeitig Mitschüler mit einer belasteten Kindheit besser verstehen ließe.
Für den allgemeinen politischen Diskurs regt Sven Fuchs durch die Kindheitsbeschreibungen von noch lebenden politischen Akteuren eine hilfreiche Einordnung der weltpolitischen Vorkommnisse an. Auch wenn hier die persönlichen Handlungsmöglichkeiten weitgehend fehlen, gibt ein solches Wissen mehr Sicherheit. Ebenso können sowohl die Bevölkerungsgruppen und Parteien eingeordnet werden, die „aus der Geschichte nichts lernen“ als auch die rechtsextremistischen Bestrebungen in allen europäischen Gesellschaften.
Bindung fördernde gesellschaftliche Strukturen stärken!
Was kann aus diesen Erkenntnissen für das globale Aufwachsen von Kindern geschlossen werden? Die derzeit überall gesellschaftlich favorisierte institutionelle Erziehung und die allgemeine Abwertung der Familienerziehung kann nicht die Lösung sein. Das beweist ein Blick auf die von allen Ländern (bis auf Westdeutschland) seit Jahrzehnten praktizierte Ganztagsbetreuung von Anfang an; hier ist besonders der Rechtsextremismus auffallend stärker.
Herbert Renz-Polster hat dies in seinem aktuellen Buch Erziehung prägt die Gesinnung beschrieben. Das physisch und psychisch lebenswichtige familiäre Zusammenleben muss stattdessen in jeglicher Form unterstützt werden. Besonders wenn Eltern selbst destruktive Kindheitserfahrung haben, benötigen sie Hilfe, um diese nicht an die eigenen Kinder weiterzugeben. Hier lohnt jeder Einsatz, denn die Fähigkeit zu sozialen Bindungen wird in den ersten Jahren in den familiären Beziehungen erlebt und gelernt.
Dies hat Lloyd deMause in den 1970-er Jahren mit seinem Buch „Hört ihr die Kinder weinen“ ebenso gezeigt wie der Historiker Michael Hüter, der derzeit mit seinem Buch Kindheit 6/7 über gesellschaftstragende positive Familienerfahrungen von einer großen Zahl erfolgreicher Zeitgenossen berichtet.
Gewaltfreie Erziehung ist Grundlage für die friedliche Entwicklung ganzer Gesellschaften
Sven Fuchs ist es gelungen, mit diesem zugleich schrecklichen und großartigen Buch genau aufzuzeigen, warum die individuellen Folgen der Gewalt gegen Kinder zu gesellschaftlichen Folgen werden, unter denen besonders Unbeteiligte leiden müssen. Diese präzise herausgearbeiteten Erkenntnisse erfordern eine über die Frühen Hilfen hinausgehende umfassende Unterstützung von familiären Erziehungsleistungen. Beziehungsfähigkeit, soziales Denken und Verstehen lernt das Kind in den ersten drei bis vier Lebensjahren und darüber hinaus in seiner Familie.
Weil in dieser frühen Zeit das soziale Verstehen der Kinder noch unterentwickelt ist, kam und kommt es zu gewaltsamen autoritären Erziehungshandlungen. Wollen Eltern mit kritischer Kindheitserfahrung das jedoch vermeiden, geraten sie unter Stress angesichts der fehlenden Einsichtsfähigkeit bei kleinen Kindern. Hier ist auch heute noch viel Aufklärung über die Entwicklung des sozialen Denken und Verstehens nötig.
Dem Buch ist eine weite Verbreitung sowohl unter allen an der Erziehung von Kindern Beteiligten als auch unter den gesellschaftspolitischen Akteuren zu wünschen. Mit diesem kompakten Wissen haben wir einen Ansatz, über die allgemeine und erzieherische Unterstützung von Familien in allen Gesellschaften ein friedlicheres Miteinander auf den Weg zu bringen.
Über den Buchautor: Sven Fuchs
geb. 1977, Vater von zwei Kindern, selbstständiger Kaufmann, studierte an der Universität Hamburg Soziologie, Politik und Psychologie und beschäftigt sich in seinem Blog (seit 2008) „Kriegsursachen, Destruktive Politik und Kindheit“ mit der weltweiten Gewalt gegen Kinder als zentralen Aspekt in der Kriegsursachen-Forschung. Er ist Mitglied der Gesellschaft für Psychohistorie und Politische Psychologie (GPPP) Eine frühe Fassung seiner Thesen: „Als Kind geliebte Menschen fangen keine Kriege an: Plädoyer für einen offenen Blick auf die Kindheitsursprünge von Kriegen, Arbeitspapiere zur Internationalen Politik und Außenpolitik 4/2012