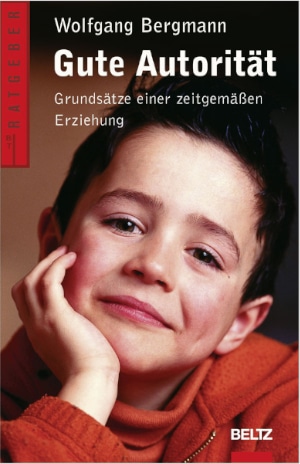 Erziehungsideale nehmen in ihrer Geschichte häufig einen wellenförmigen Verlauf. Auf eine auf Autorität und Unterwerfung des Kindes abzielende „schwarze Pädagogik“ in der deutschen Nachkriegszeit folgte als Gegenbewegung die Propagierung „anti-autoritärer“ Erziehungsprinzipien der 68er Bewegung, bevor dann in den 1980er Jahren als eine Art von Kompromiss ein „autoritativer“ Erziehungsstil empfohlen wurde. Dieser zeichnet sich bis heute dadurch aus, dem Kind respektvoll und auf Augenhöhe zu begegnen und ihm gleichzeitig Regeln für sein Verhalten zu vermitteln.
Erziehungsideale nehmen in ihrer Geschichte häufig einen wellenförmigen Verlauf. Auf eine auf Autorität und Unterwerfung des Kindes abzielende „schwarze Pädagogik“ in der deutschen Nachkriegszeit folgte als Gegenbewegung die Propagierung „anti-autoritärer“ Erziehungsprinzipien der 68er Bewegung, bevor dann in den 1980er Jahren als eine Art von Kompromiss ein „autoritativer“ Erziehungsstil empfohlen wurde. Dieser zeichnet sich bis heute dadurch aus, dem Kind respektvoll und auf Augenhöhe zu begegnen und ihm gleichzeitig Regeln für sein Verhalten zu vermitteln.
Mit den Büchern des Psychiaters Michael Winterhoff „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“ und des Lehrers Bernhard Bueb „Lob der Disziplin“ – zwei der bis heute in Millionenhöhe meistverkauften Elternratgeber – erlebte das Vermächtnis einer auf Unterordnung und blinden Gehorsam beruhenden Erziehung Anfang der 2000er Jahre eine Art Revival.
Parallel dazu plädierten der dänische Familientherapeut Jesper Juul, der Schweizer Kinderarzt Remo Largo und andere in ihren Erziehungsratgebern wiederum für einen das Kind würdigenden beziehungsfreundlichen Erziehungsstil, der seine Selbstverantwortung, Einzigartigkeit und Autonomie stärken sollte.
Heute erleben wir wieder einmal einen leichten Wandel in der Erziehungsdebatte. Da wird eine beziehungs- und bindungsfreundliche Erziehung mit „bedürfnisorientierter“ Erziehung gleichgesetzt und dahingehend kritisiert, dass sie zu einer unnötigen Belastung der Eltern führen würde.
Und plötzlich tauchen auf den Werbetexten von Büchern wieder Begriffe wie „gute Autorität“ und „Führung“ auf, ganz offensichtlich, um einen herrschenden Zeitgeist bedienen zu wollen. Artikel in den Leitmedien wie „Wenn Mütter zu sehr an Bindung glauben“ oder solche, die für eine Erziehung plädieren, unsere Kinder wieder zu mehr Leistungswillen anzuhalten, machen die Runde.
Wieder einmal wird deutlich, dass Erziehungsfragen immer auch gesellschaftspolitischen Tendenzen entsprechen. Zeit also für einige Klarstellungen.
Warum bindungsorientierte Erziehung mehr ist als Wunscherfüllung
 Der Begriff einer „bedürfnisorientierter Erziehung“ lädt zu einer Reihe von Missverständnissen ein, deren sich Kritiker einer bindungsfreundlichen Erziehung gerne bedienen. Zum Beispiel das Missverständnis, Eltern sollten möglichst auf jedes Bedürfnis ihres Kindes eine Antwort geben oder eingehen. Das aber ist, wie alle Eltern wissen, im Erziehungsalltag so gut wie nicht möglich. Und würde auch keinem Kind wirklich guttun. Schließlich macht es die Erfahrung, mit zunehmendem Alter und außerhalb seines Elternhauses mit seinen spontanen Wünschen und Bedürfnissen immer wieder auf Widerstände, aber auch auf Ablehnung zu stoßen, sei es in der Kita, der Schule oder im Zusammensein mit anderen Kindern. Ein Kind sollte bei sich zuhause mit freundlicher Zuneigung und Unterstützung seiner Eltern also gelernt haben, wie man damit am besten umgeht.
Der Begriff einer „bedürfnisorientierter Erziehung“ lädt zu einer Reihe von Missverständnissen ein, deren sich Kritiker einer bindungsfreundlichen Erziehung gerne bedienen. Zum Beispiel das Missverständnis, Eltern sollten möglichst auf jedes Bedürfnis ihres Kindes eine Antwort geben oder eingehen. Das aber ist, wie alle Eltern wissen, im Erziehungsalltag so gut wie nicht möglich. Und würde auch keinem Kind wirklich guttun. Schließlich macht es die Erfahrung, mit zunehmendem Alter und außerhalb seines Elternhauses mit seinen spontanen Wünschen und Bedürfnissen immer wieder auf Widerstände, aber auch auf Ablehnung zu stoßen, sei es in der Kita, der Schule oder im Zusammensein mit anderen Kindern. Ein Kind sollte bei sich zuhause mit freundlicher Zuneigung und Unterstützung seiner Eltern also gelernt haben, wie man damit am besten umgeht.
Um das Missverständnis zu vermeiden, dass Eltern ihren Kindern bei möglichst vielen, wenn nicht sogar sämtlichen Bedürfnissen entgegenkommen sollen, ist es also angebracht, statt von „bedürfnisorientierter Erziehung“ von „bindungsorientierter Erziehung“ und ihren positiven Folgen für Kinder und Eltern zu sprechen. Dazu gilt es, zwischen zwei Arten von Bedürfnissen zu unterscheiden: Den grundlegenden Bedürfnissen jedes Kindes, die ich „existentielle Bedürfnisse“ nenne, und solchen Bedürfnissen, die auf bloße Wunscherfüllung hinauslaufen.
Die Anerkennung existenzieller Bedürfnisse besonders in der frühen Kindheit ist ein Geschenk – für Kinder UND ihre Eltern.
Welche Bedürfnisse eines Kindes sind wirklich wichtig?
 Auch bei der „bindungsorientierten Erziehung“ geht es um Bedürfnisse und zwar um solche, deren Erfüllung jedem Kind von Beginn seines Lebens an eine gute Bindung zu seinen Eltern ermöglichen. Ich nenne sie, weil sie so bedeutend für die gesunde Entwicklung jedes Kindes sind, für das Kind „existentiellen Bedürfnisse“. Eltern sollten ihnen, soweit es die äußeren Umstände erlauben, möglichst oft entgegenkommen. In einzelnen geht es um folgende elementare Bedürfnisse eines Kindes:
Auch bei der „bindungsorientierten Erziehung“ geht es um Bedürfnisse und zwar um solche, deren Erfüllung jedem Kind von Beginn seines Lebens an eine gute Bindung zu seinen Eltern ermöglichen. Ich nenne sie, weil sie so bedeutend für die gesunde Entwicklung jedes Kindes sind, für das Kind „existentiellen Bedürfnisse“. Eltern sollten ihnen, soweit es die äußeren Umstände erlauben, möglichst oft entgegenkommen. In einzelnen geht es um folgende elementare Bedürfnisse eines Kindes:
- Sicherheit und Geborgenheit: „Egal was auch passiert, ihr seid für mich da, ich kann euch vertrauen.“
- Resonanz: „Ich werde gehört und gesehen.“
- Anerkennung: „Ich bin wertvoll für euch.“
- Selbstwirksamkeit: „Was ich mir vornehme, das gelingt mir auch, nicht immer, aber doch meistens.“
Finden diese Bedürfnisse in der frühen Kindheit genügend Beachtung, ist der alltägliche Umgang mit solchen Kindern im Übrigen auch viel entspannter. Mit anderen Worten: Gerade solche Kinder, die in einer bindungsfreundlichen Atmosphäre aufwachsen, machen, salopp ausgedrückt, weniger Ärger, bereiten ihren Eltern weniger Stress.
Sie fühlen sich im Großen und im Ganzen sicher, geborgen und so, wie sie sind, akzeptiert, weswegen sie mit Enttäuschungen oder der Ablehnung von spontanen Wünschen meistens viel gelassener umgehen können – und dies auch in einer für sie fremden Umgebung.
Sie tragen den „sicheren Hafen“ ihrer Eltern wie eine Schutzfunktion in sich. Davon profitieren auch ihre Eltern, denn es kommt im Erziehungsalltag zu weitaus weniger Konflikten als mit Kindern, die in einer bindungsarmen Atmosphäre aufwachsen und die immer darum kämpfen müssen, gehört und gesehen zu werden. Außerdem verlernen Kinder, deren Eltern sich ständig um sie kümmern, ihnen stets jeden Wunsch von den Augen ablesen, selbstständig zu werden bzw. angemessen mit Konflikten umzugehen. So, wie Eltern lernen müssen, einmal loslassen zu können, müssen es auch ihre Kinder lernen!
Was passiert, wenn die existenziellen Bedürfnisse eines Kindes nicht erwidert werden?
 Kinder, deren existenzielle Bedürfnisse nur unzureichend begegnet wird, greifen mit ihren Versuchen, von Geburt an eine sichere Brücke hin zu ihren Eltern zu bauen, zu oft ins Leere. Ihre innere Welt ist von Unsicherheit und Verlustängsten bestimmt. Sie fühlen sich abgelehnt und zunehmend wertlos. Manche von ihnen ziehen sich ängstlich vor der Welt, die sie für sich als bedrohlich erleben, zurück, die meisten, zumindest wenn sie noch klein sind, aber unternehmen alles, um endlich gehört und gesehen zu werden, und für andere so sichtbar zu bleiben. Mit leider oft kontraproduktiven Mitteln suchen sie dann bei sich zuhause, später auch in der außerhäuslichen Betreuung oder in der Schule ständig nach Aufmerksamkeit.
Kinder, deren existenzielle Bedürfnisse nur unzureichend begegnet wird, greifen mit ihren Versuchen, von Geburt an eine sichere Brücke hin zu ihren Eltern zu bauen, zu oft ins Leere. Ihre innere Welt ist von Unsicherheit und Verlustängsten bestimmt. Sie fühlen sich abgelehnt und zunehmend wertlos. Manche von ihnen ziehen sich ängstlich vor der Welt, die sie für sich als bedrohlich erleben, zurück, die meisten, zumindest wenn sie noch klein sind, aber unternehmen alles, um endlich gehört und gesehen zu werden, und für andere so sichtbar zu bleiben. Mit leider oft kontraproduktiven Mitteln suchen sie dann bei sich zuhause, später auch in der außerhäuslichen Betreuung oder in der Schule ständig nach Aufmerksamkeit.
Um Aufmerksamkeit zu bekommen, „stören“ sie, werden laut oder auch aggressiv – Hauptsache, „jemand kümmert sich um mich!“
In den meisten Fällen stoßen sie damit jedoch auf Ablehnung, ein Gefühl, das sie zuhause bei ihren Eltern bereits kennengelernt haben. Ein Teufelskreis entsteht und es ist schwierig für sie, dort wieder herauszufinden.
Deswegen plädiere ich auch für bindungssichere Kitas und Schulen, um den Kindern ein wenig von dem zurückzugeben, was sie bei sich zuhause gar nicht oder nur zu wenig kennengelernt haben.
Wie gelingt es Eltern, die Bedürfnisse hinter dem Verhalten ihres Kindes zu erkennen?
 Natürlich können Eltern auf die elementaren Bedürfnisse eines Kindes nach Nähe und dem Gefühl, gehört und gesehen zu werden, nicht ständig sofort eingehen. Eltern können, sowohl zuhause als auch anderswo, nicht immer für ihre Kinder da sein. Daran müssen sie sich gewöhnen und mit kurzfristigen Enttäuschungen fertig werden. Wenn Eltern es ihnen liebevoll erklären, nicht ellenlang, sondern mit weniger Worten, reicht das. So wie Kinder lernen müssen loszulassen, müssen es auch ihre Eltern lernen.
Natürlich können Eltern auf die elementaren Bedürfnisse eines Kindes nach Nähe und dem Gefühl, gehört und gesehen zu werden, nicht ständig sofort eingehen. Eltern können, sowohl zuhause als auch anderswo, nicht immer für ihre Kinder da sein. Daran müssen sie sich gewöhnen und mit kurzfristigen Enttäuschungen fertig werden. Wenn Eltern es ihnen liebevoll erklären, nicht ellenlang, sondern mit weniger Worten, reicht das. So wie Kinder lernen müssen loszulassen, müssen es auch ihre Eltern lernen.
Das Entscheidende ist, dass zuhause insgesamt eine bindungsfreundliche Atmosphäre herrscht und sich das Kind in all seiner Zuwendung zu seinen Bezugspersonen angenommen fühlt, auch wenn seine Bedürfnisse nicht immer angenommen werden.
Bloße Wünsche eines Kindes, etwa nach etwas Süßem, nach neuem Spielzeug, nach Fernseh- oder Videozeit, nach ständiger Aufmerksamkeit usw. unterscheiden sich völlig von den genannten elementaren Bedürfnissen.
Man kann es seinen Reaktionen gut ansehen. Werden existenzielle Bedürfnisse des Kindes dauerhaft verletzt, wird der Blick eines Kindes traurig und leer und in seiner Körperhaltung, seinen Gesten und Worten drückt sich große Angst aus. Angst, verlassen zu werden. Im Unterschied zum trotzig-forderndem Jammern und Weinen, wenn es einen spontanen Wunsch nicht erfüllt bekommt, hört sich sein Weinen verzweifelt an.
Verwehren Eltern ihrem Kind die Erfüllung eines bloßen Wunsches, wird es durchaus protestieren, manchmal auch lautstark. Aber weil sein Gefühl, sich weiterhin sicher, geborgen, geliebt und anerkannt zu fühlen, nicht verletzt wird und sich in seiner Entwicklung die meiste Zeit gehört und gesehen fühlt, wird es sich schon kurze Zeit später danach wieder mit Freude und Zuversicht seinen Eltern zuwenden.
Es ist also Unsinn, bei einer bindungsfördernden Erziehung von Verwöhnung zu sprechen oder den Verdacht zu äußern, das Kind bekäme dann niemals genug. Das Gegenteil ist der Fall.
Eine bindungsfreundliche Erziehung verschafft Eltern viel mehr Ruhe und größere Spielräume, auch ihre eigenen Interessen wahrzunehmen.
Viele Konflikte, wie sie mit bindungsschwachen Kindern entstehen, die ihre mangelnde Bindung zu ihren Eltern immer wieder durch ihre übertriebene Suche nach Aufmerksamkeit kompensieren wollen, fallen hier weg.
Sorgt eine bindungsfreundliche Erziehung für mehr Elternstress?
 Eltern stehen heute unter starkem gesellschaftlichem Druck. Ihre Kinder sollen stark sein, erfolgreich und glücklich. Das predigen nicht nur unzählige Elternratgeber, sondern derlei Ratschläge finden sich ebenso im Netz bei „Mom-Fluencer:innen, in der Werbung oder in unzähligen Videos auf Insta oder TikTok. Und da die allermeisten Eltern wollen, dass es ihren Kindern möglichst immer gut geht, verfangen diese Erziehungsrezepte, obwohl es doch völlig unmöglich ist, ein Kind, das immer nur glücklich ist, um sich zu haben.
Eltern stehen heute unter starkem gesellschaftlichem Druck. Ihre Kinder sollen stark sein, erfolgreich und glücklich. Das predigen nicht nur unzählige Elternratgeber, sondern derlei Ratschläge finden sich ebenso im Netz bei „Mom-Fluencer:innen, in der Werbung oder in unzähligen Videos auf Insta oder TikTok. Und da die allermeisten Eltern wollen, dass es ihren Kindern möglichst immer gut geht, verfangen diese Erziehungsrezepte, obwohl es doch völlig unmöglich ist, ein Kind, das immer nur glücklich ist, um sich zu haben.
Hinzukommen noch ganz andere handfeste Probleme, die Eltern gehörigen Stress machen: Das Fehlen von ausreichenden Krippen- und Kitaplätzen, die mangelnde Qualität der Betreuung oder die ständigen Ausfallzeiten wegen Personalmangel oder Krankheit. Die Vereinbarkeit von Beruf und Kindern ist, obwohl gesetzlich angestrebt, paradoxerweise für viele Eltern heutzutage immer schwieriger geworden, in manchen Fällen sogar fast unmöglich.
Nicht die bindungsfreundliche Erziehung ist Auslöser von Stress und Burnout, keine mangelnde Autorität und kein fehlender „Führungswillen“. Im Gegenteil.
Eine bindungsfreundliche Atmosphäre in der Familie ist eine gute Basis, mit den spontanen Wünschen und auch den alltäglichen Problemen von Kindern entspannt umzugehen. Und zwar auf beiden Seiten!
Sie sorgt dafür, dass es Kindern UND ihren Eltern gut geht. Sie sorgt für weniger Elternstress statt für mehr.
von Claus Koch
Quellenangaben




